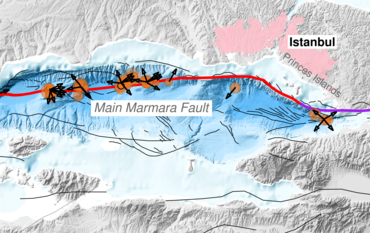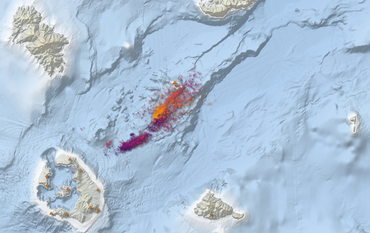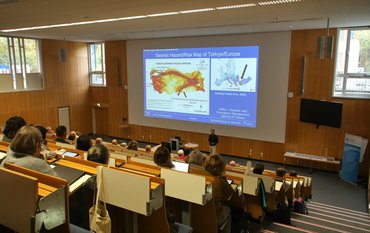Um der wachsenden Bedeutung von Open Science, einer Bewegung hin zu mehr Transparenz und Offenheit im Wissenschaftsprozess, gerecht zu werden, hat das GFZ-Department „Geoinformation“ am 3. März 2025 den 1. Open-Science-Tag am GFZ organisiert. In Vorträgen, Workshops und einer Podiumsdiskussion wurde über praktische Aspekte einer offenen Wissenschaft und über neue Wege der Bewertung von Wissenschaft am GFZ und in den Geowissenschaften berichtet und diskutiert.
Hintergrund: Open Science
Die zunehmende Digitalisierung eröffnet ganz neue Möglichkeiten für das wissenschaftliche Arbeiten. Dadurch gewinnen Wissenschaftspraktiken an Bedeutung, die unter dem Begriff „Open Science“ zusammengefasst werden. Ziel ist es, die im Laufe des Forschungsprozesses entstehenden Proben, Daten, Software, Publikationen und Lehrmaterialien möglichst frei zugänglich zu gestalten. So soll Forschung transparenter, nachvollziehbarer, reproduzierbarer und sichtbarer werden. Zu Open-Science-Praktiken gehören zum Beispiel das Publizieren der wissenschaftlichen Ergebnisse in sogenannten Open Access Journalen, also die Möglichkeit wissenschaftliche Artikel ohne Linzenzhürden lesen zu können. Weitere Themen sind das Gewähren eines offenen Zugangs zu Forschungsdaten, Modellen, Algorithmen und anderen Forschungsergebnissen gemäß den FAIR-Prinzipien (auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar), aber auch das Öffnen der Wissenschaft in andere Bereiche der Gesellschaft, zum Beispiel durch Stärkung des Austauschs mit Politik oder durch „Citizen Science“/Bürgerwissenschaft. Dahinter steht auch das Ziel, das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken (vgl. Open Science Policy der EU).
All das fördert unmittelbar den weltweiten Austausch wissenschaftlicher Ergebnisse und eröffnet neue Formen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Darüber hinaus ermöglicht es aber auch digitale Innovationen– mit einzigartigem wissenschaftlichem, gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Potenzial.
Der Open-Science-Day am GFZ
Die wissenschaftliche Vorständin des GFZ, Prof. Dr. Susanne Buiter, unterstrich in ihrer Begrüßung die wichtige Rolle von Open Science, gerade für die Erd- und Umweltwissenschaften. Im Anschluss bot der Vormittag spannende Einblicke in zentrale Open-Science-Themen.
Luise Ott, Leiterin der Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert Einstein, machte den Auftakt und stellte die Grundzüge einer Open-Access-Strategie für das GFZ vor. Dabei ging sie von der bisher erreichten Open Access-Quote bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen des GFZ aus (84,4% für das Publikationsjahr 2022) und zeigte an fünf Handlungsfeldern auf, wie das Erreichen der in der Selbstverpflichtung der Helmholtz Zentren anvisierten 100%-Open Access-Quote erreicht werden soll.
Im Anschluss stellte Marcel Meistring, Interimsleiter der Sektion Daten- und Informationsmanagement, den Fachinformationsdienst Geowissenschaften vor. Meistring nutzte als Basis eine Präsentation von Melanie Lorenz. Der Fachinformationsdienst Geowissenschaften (FID Geo) wird von Sektion 5.1 und der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen betrieben. Er bietet der geowissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft in Deutschland nicht nur umfangreiche Vernetzung- und Beratungsangebote, sondern auch wichtige Infrastrukturen zur offenen Publikation von Forschungsdaten und Texten, zum Beispiel die Dienste „GFZ Data Services“ und „GEO-LEOe-docs“.
Im dritten Impulsvortrag von Dr. Mathijs Vleugel, Leiter des Helmholtz Open Science Office, wurde das Thema der Bewertung von Wissenschaft beleuchtet. Dabei stellte er verschiedene Initiativen vor, die mit alternativen Bewertungsmethoden für die Beurteilung wissenschaftlicher Qualität einer Überbewertung zitationsbasierter Metriken entgegenwirken wollen.
Fragen zur Handlungssicherheit im Kontext von Open Science adressierte Prof.Dr. Wolfgang zu Castell, Direktor von Department 5 und Sprecher des Arbeitskreises Open Science der Helmholtz Gemeinschaft,. Ausgehend von der aktuell angespannten geopolitischen Lage wird das offene Teilen von Forschungsergebnissen immer wieder der Wahrung von Sicherheitsinteressen gegenübergestellt. Nachdem das Anliegen von Open Science der konsequenten Umsetzung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis entspräche, dürften die Grundanliegen von Open Science nicht anderen Interessen geopfert werden. Als ein Beispiel für einen möglichen Umgang mit solchen Spannungsfeldern berichtete er aus dem Dialog der Helmholtz-Gemeinschaft mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (Chinese Academy of Science CAS).
Den Abschluss bildete ein inspirierender Vortrag von Deborah Schmidt (Max-Delbrück-Zentrum und Helmholtz Imaging) die in die vielfältigen Aktivitäten und Unterstützungsangebote der Plattform Helmholtz Imaging einführte. Helmholtz-Imaging ist neben der Helmholtz-Metadata-Collaboration (HMC) eine weitere Plattform des Helmholtz Information & Data Science Frameworks. Deborah Schmidt schlug eine ideale Brücke zur Eröffnung der Ausstellung des Best Scientific Image Wettbewerbs, die noch bis zum 14. April in der Bibliothek des Wissenschaftsparks auf dem Telegrafenberg zu besichtigen ist.
Weitere Informationen und interessante Ressourcen:
- Support Seiten GFZ data Services
- Open Access-Publizieren am GFZ
- Intranet Seiten zu Open Science @GFZ
- FERN.Lab Cookiecutter: Möchten Sie in die nachhaltige Softwareentwicklung einsteigen? Werfen Sie einen Blick auf die FERN.Lab Cookiecutter-Repository-Vorlagen, die eine faire und offene Wissenschaft ermöglichen, indem sie z. B. saubere Programmierung, automatisierte Dokumentation und CI/CD-Pipeline-Integration sowie die Vorbereitung von Veröffentlichungen durch eine integrierte Verbindung zu z. B. pypi und zenodo unterstützen.
Nehmen Sie an unserem praktischen Cookiecutter-Workshop am 01.04. oder 10.04. am GFZ teil! Bitte melden Sie sich hier an: https://nuudel.digitalcourage.de/DiNvbhvRbB5xrYKn